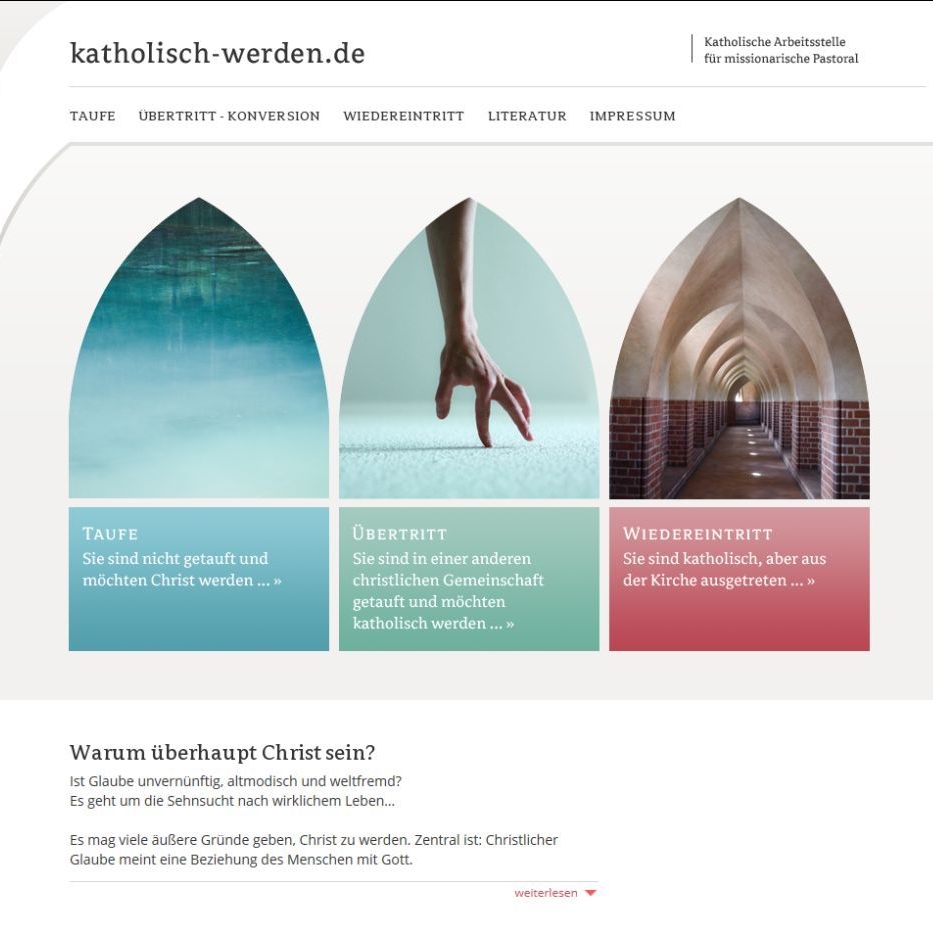Pfarrei "St. Trinitas" Guben
Katholische Kirche
Berufen, Hoffnung zu säen und Frieden zu schaffen

Botschaft von Papst Franziskus zum Weltgebetstag um geistliche Berufungen
Liebe Brüder und Schwestern!
Der Weltgebetstag um geistliche Berufungen lädt uns jedes Jahr dazu ein, über das kostbare Geschenk des Rufs nachzudenken, den der Herr an einen jeden von uns richtet, an sein gläubiges Volk, das sich auf dem Weg befindet, damit wir an seinem Plan der Liebe teilhaben und die Schönheit des Evangeliums in den verschiedenen Lebensständen Gestalt annehmen lassen können. Auf den göttlichen Ruf zu hören, ist keineswegs eine von außen auferlegte Pflicht, vielleicht im Namen eines religiösen Ideals, es ist vielmehr der sicherste Weg, den wir haben, um die Sehnsucht nach Glück zu nähren, die wir in uns tragen: Unser Leben verwirklicht und erfüllt sich, wenn wir entdecken, wer wir sind, welches unsere Stärken sind, in welchem Bereich wir sie fruchtbar werden lassen können, welchen Weg wir gehen können, um in unserem jeweiligen Lebensumfeld ein Zeichen und ein Werkzeug der Liebe, der Gastfreundschaft, der Schönheit und des Friedens zu werden.
So ist dieser Tag stets eine schöne Gelegenheit, sich vor dem Herrn mit Dankbarkeit an das treue, tägliche und oft verborgene Engagement derjenigen zu erinnern, die eine Berufung angenommen haben, die ihr ganzes Leben einbezieht. Ich denke an die Mütter und Väter, die nicht in erster Linie auf sich selbst schauen und nicht dem Strom eines oberflächlichen Stils folgen, sondern ihr Leben darauf ausrichten, sich mit Liebe und Selbstlosigkeit um Beziehungen zu kümmern, indem sie sich dem Geschenk des Lebens öffnen und sich in den Dienst ihrer Kinder und deren Heranwachsens stellen. Ich denke an all diejenigen, die ihre Arbeit mit Hingabe und im Geiste der Zusammenarbeit verrichten; an diejenigen, die sich in verschiedenen Bereichen und auf unterschiedliche Weise für den Aufbau einer gerechteren Welt, einer solidarischeren Wirtschaft, einer faireren Politik und einer menschlicheren Gesellschaft einsetzen: an alle Männer und Frauen guten Willens, die sich dem Gemeinwohl verschrieben haben. Ich denke an die Personen des geweihten Lebens, die ihr Leben dem Herrn in der Stille des Gebets wie auch im apostolischen Wirken hingeben, manchmal in Randgebieten und ohne sich zu schonen, indem sie ihr Charisma kreativ entfalten und es jenen zur Verfügung stellen, denen sie begegnen. Und ich denke an diejenigen, die die Berufung zum Weihepriestertum angenommen haben und sich der Verkündigung des Evangeliums widmen und ihr Leben zusammen mit dem eucharistischen Brot für ihre Brüder und Schwestern hingeben, indem sie Hoffnung säen und allen die Schönheit des Reiches Gottes aufzeigen.
Den jungen Menschen, vor allem denjenigen, die der Kirche fernstehen oder Misstrauen gegen sie hegen, möchte ich sagen: Lasst euch von Jesus faszinieren, stellt ihm durch die Seiten des Evangeliums eure wichtigen Fragen, lasst euch von seiner Gegenwart aufrütteln, die uns immer in wohltuender Weise in Frage stellt. Er respektiert unsere Freiheit mehr als jeder andere, er drängt sich nicht auf, sondern bietet sich selbst an: Gebt ihm Raum und ihr werdet euer Glück darin finden, ihm zu folgen und, falls er euch darum bittet, euch ihm ganz hinzugeben.
Ein Volk auf dem Weg
Die Vielstimmigkeit der Charismen und Berufungen, die die christliche Gemeinschaft anerkennt und unterstützt, hilft uns, unsere Identität als Christen voll und ganz zu verstehen: Als Volk Gottes, das auf den Straßen der Welt unterwegs ist, beseelt vom Heiligen Geist und als lebendige Steine in den Leib Christi eingefügt, entdeckt sich ein jeder von uns als Mitglied einer großen Familie, als Kind des Vaters und als Bruder und Schwester unserer Mitmenschen. Wir sind keine in sich selbst verschlossene Einheiten, sondern Teile des Ganzen. Deshalb trägt der Weltgebetstag um geistliche Berufungen den Stempel der Synodalität: Es gibt viele Charismen und wir sind aufgerufen, einander zuzuhören und gemeinsam unterwegs zu sein, um sie zu entdecken und zu unterscheiden, wozu der Geist uns zum Wohle aller ruft.
In diesem Augenblick der Geschichte führt uns der gemeinsame Weg ferner auf das Jubiläumsjahr 2025 hin. Gehen wir auf das Heilige Jahr als Pilger der Hoffnung zu, damit wir – indem wir unsere eigene Berufung wiederentdecken und die verschiedenen Gaben des Geistes miteinander in Beziehung setzen – in der Welt Mittler und Zeugen des Traums Jesu sein können: eine einzige Familie zu bilden, die in der Liebe Gottes vereint und durch das Band der Nächstenliebe, des Teilens und der Geschwisterlichkeit verbunden ist.
Dieser Tag ist insbesondere dem Gebet gewidmet, um vom Vater die Gabe geistlicher Berufungen für den Aufbau seines Reiches zu erbitten: »Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden!« (Lk 10,2). Und das Gebet – das wissen wir – besteht mehr aus Zuhören als aus an Gott gerichteten Worten. Der Herr spricht zu unserem Herzen und möchte es offen, aufrichtig und großzügig vorfinden. Sein Wort ist in Jesus Christus Fleisch geworden, der uns den ganzen Willen des Vaters offenbart und mitteilt. In diesem Jahr 2024, das eben dem Gebet zur Vorbereitung des Jubiläums gewidmet ist, sind wir aufgerufen, das unschätzbare Geschenk wiederzuentdecken, mit dem Herrn von Herz zu Herz in Dialog treten zu können und so zu Pilgern der Hoffnung zu werden, denn »das Gebet ist die erste Kraft der Hoffnung. Du betest, und die Hoffnung wächst, sie geht voran. Ich würde sagen, dass das Gebet die Tür zur Hoffnung öffnet. Die Hoffnung ist da, aber mit meinem Gebet öffne ich die Tür.« (Katechese, 20. Mai 2020).
Pilger der Hoffnung und Friedensstifter
Aber was bedeutet es, Pilger zu sein? Wer eine Pilgerreise unternimmt, sucht zuerst das Ziel zu klären und trägt es immer im Kopf und im Herzen. Um jenes Ziel zu erreichen, muss man sich jedoch gleichzeitig auf die gegenwärtige Etappe konzentrieren. Um diese anzugehen, darf man nicht schwer beladen sein, muss sich von unnötigen Lasten befreien, das Wesentliche mitnehmen und jeden Tag kämpfen, damit Müdigkeit, Angst, Unsicherheit und Dunkelheit den begonnenen Weg nicht verstellen. Pilger zu sein bedeutet also, jeden Tag neu aufzubrechen, immer wieder neu anzufangen, den Enthusiasmus und die Kraft wiederzuentdecken, die verschiedenen Etappen des Weges zurückzulegen, die trotz der Müdigkeit und der Schwierigkeiten immer wieder neue Horizonte und unbekannte Ausblicke vor uns eröffnen.
Der Sinn des christlichen Pilgerns ist eben dies: Wir befinden uns auf einem Weg, um Gottes Liebe zu entdecken und zugleich uns selbst zu entdecken, durch eine innere Reise, die aber immer durch die Vielfalt der Beziehungen angeregt wird. Wir sind also Pilger, weil wir berufen sind: berufen, Gott zu lieben und uns gegenseitig zu lieben. So endet unser Weg auf dieser Erde niemals in sinnloser Mühe oder ziellosem Umherirren. Indem wir unserer Berufung folgen, versuchen wir jeden Tag vielmehr die möglichen Schritte auf eine neue Welt hin zu gehen, in der wir in Frieden, Gerechtigkeit und Liebe leben. Wir sind Pilger der Hoffnung, weil wir nach einer besseren Zukunft streben und uns bemühen, sie entlang des Weges aufzubauen.
Dies ist letztlich das Ziel jeder Berufung: Männer und Frauen der Hoffnung zu werden. Als Einzelne und als Gemeinschaft, in der Vielfalt der Charismen und der Dienste, sind wir alle aufgerufen, der Hoffnung des Evangeliums „Leib und Herz zu geben“ in einer Welt, die von epochalen Herausforderungen geprägt ist: dem bedrohlichen Voranschreiten eines dritten Weltkriegs in Stücken; den Scharen von Migranten, die auf der Suche nach einer besseren Zukunft aus ihren Heimatländern fliehen; der ständig wachsenden Zahl von Armen; der Gefahr, das Wohlergehen unseres Planeten unwiderruflich zu beeinträchtigen. Und zu all dem kommen noch die Schwierigkeiten hinzu, denen wir tagtäglich begegnen und die uns manchmal in Resignation oder Defätismus zu stürzen drohen.
In dieser unserer Zeit ist es für uns Christen also entscheidend, einen hoffnungsvollen Blick zu pflegen, um entsprechend der uns anvertrauten Berufung im Dienst des Reiches Gottes, eines Reiches der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens, fruchtbar arbeiten zu können. Diese Hoffnung – so versichert uns der heilige Paulus – »lässt nicht zugrunde gehen« (Röm 5,5), denn es handelt sich um das Versprechen, das unser Herr Jesus uns gegeben hat, immer bei uns zu bleiben und uns in das Erlösungswerk einzubeziehen, das er im Herzen eines jeden Menschen und im „Herzen“ der Schöpfung vollenden will. Diese Hoffnung findet ihre treibende Mitte in der Auferstehung Christi, die »eine Lebenskraft [beinhaltet], die die Welt durchdrungen hat. Wo alles tot zu sein scheint, sprießen wieder überall Anzeichen der Auferstehung hervor. Es ist eine unvergleichliche Kraft. Es ist wahr, dass es oft so scheint, als existiere Gott nicht: Wir sehen Ungerechtigkeit, Bosheit, Gleichgültigkeit und Grausamkeit, die nicht aufhören. Es ist aber auch gewiss, dass mitten in der Dunkelheit immer etwas Neues aufkeimt, das früher oder später Frucht bringt« (Apostolisches Schreiben Evangelii gaudium, 276). Auch der Apostel Paulus erklärt, dass wir »auf Hoffnung hin« gerettet sind (Röm 8,24). Die zu Ostern vollbrachte Erlösung schenkt Hoffnung, eine sichere, verlässliche Hoffnung, mit der wir die Herausforderungen der Gegenwart angehen können.
Pilger der Hoffnung und Friedensstifter zu sein, bedeutet also, die eigene Existenz auf den Felsen der Auferstehung Christi zu gründen und zu wissen, dass keine unserer Mühen vergeblich ist, die wir in der Berufung erbringen, die wir angenommen haben und fortführen. Trotz Misserfolgen und Stillständen wächst das Gute, das wir säen, in aller Stille, und nichts kann uns von unserem letzten Ziel trennen: der Begegnung mit Christus und der Freude, auf ewig in Geschwisterlichkeit miteinander zu leben. Diese letztgültige Berufung müssen wir jeden Tag vorwegnehmen: Denn die Beziehung der Liebe zu Gott und zu unseren Brüdern und Schwestern beginnt schon jetzt, den Traum Gottes zu verwirklichen, den Traum von Einheit, Frieden und Geschwisterlichkeit. Niemand soll sich von diesem Ruf ausgeschlossen fühlen! Ein jeder von uns kann in seinem Umfeld, in seinem Lebensstand, mit der Hilfe des Heiligen Geistes ein Sämann der Hoffnung und des Friedens sein.
Der Mut, sich einzubringen
Aus all diesen Gründen sage ich noch einmal, wie beim Weltjugendtag in Lissabon: „Rise up! – Erhebt euch!“ Wachen wir aus dem Schlaf auf, kommen wir aus der Gleichgültigkeit heraus, öffnen wir die Gitter des Gefängnisses, in das wir uns manchmal eingeschlossen haben, damit ein jeder von uns seine Berufung in der Kirche und in der Welt entdecken und Pilger der Hoffnung und Friedensstifter werden kann! Lasst uns Leidenschaft für das Leben empfinden und uns für die liebevolle Fürsorge für die Menschen um uns herum und die Umwelt, in der wir leben, einsetzen. Ich wiederhole es: Habt den Mut, euch einzubringen! Don Oreste Benzi, ein unermüdlicher Apostel der Nächstenliebe, der immer auf der Seite der Letzten und Wehrlosen stand, pflegte zu wiederholen, dass niemand so arm ist, als dass er nicht etwas zu geben hätte, und niemand so reich ist, als dass er nicht etwas erhalten müsste.
Erheben wir uns also und machen wir uns auf den Weg als Pilger der Hoffnung, damit auch wir, wie es Maria der heiligen Elisabet gegenüber getan hat, die Freude verkünden, neues Leben hervorbringen und Baumeister der Geschwisterlichkeit und des Friedens sein können.
Rom, Sankt Johannes im Lateran, 21. April 2024, Vierter Sonntag der Osterzeit.
Franziskus p.p.
Foto: Vatican News
Kandidaten für die Pfarreiwahlen
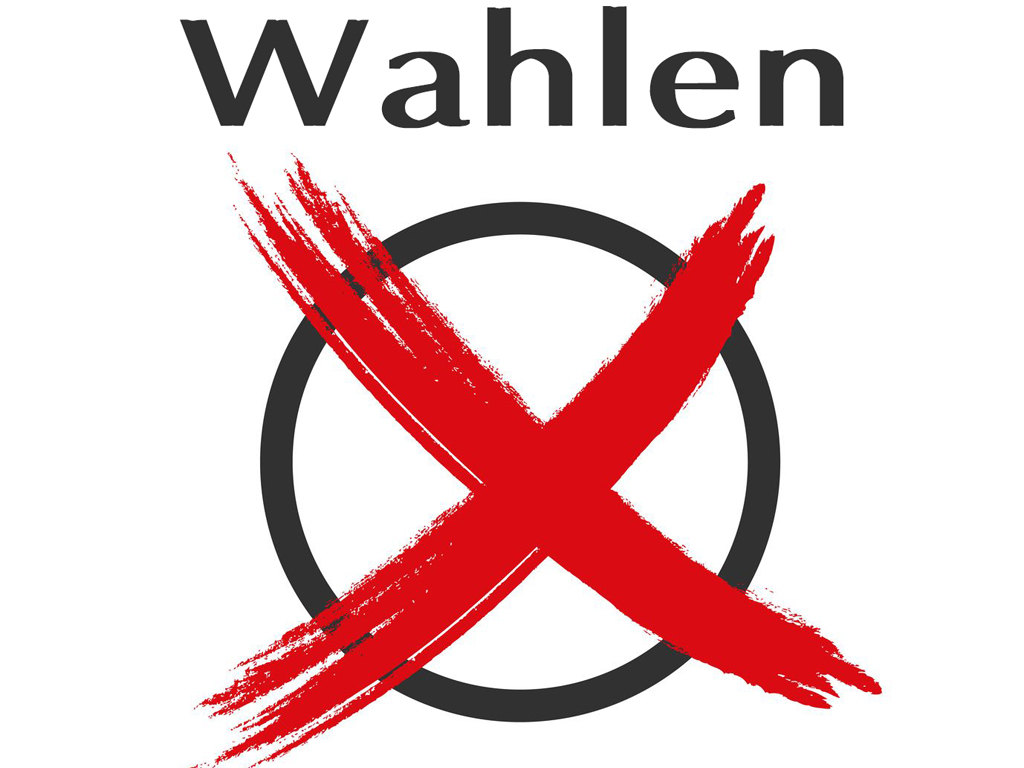
Am 5. Mai finden Wahlen zum Pfarreirat und Teilwahlen zum Kirchenvorstand statt.
Einen Monat davor werden nun die Kandidatenlisten wie folgt veröffentlicht:
Kandidaten für die Wahl des Pfarreirates:
Grimm Thomas
Hauser Barbara
Kruppa Bernadett
Plonka Gisela
Rathmann Mariola
Stachetzki Daniela
Tiller Bärbel
Turbiarz Justyna
Ulbricht Markus
Weiss Barbara
Kandidaten für die Teilwahl des Kirchenvorstands:
Emmer Margarete
Gezorreck Michael
Turbiarz Krzysztof
Wilke Thomas
Zeugen der Auferstehung

Das Leben Jesu Christi ist ein geschichtliches Ereignis. Gott ist wirklich Mensch geworden, er ist in die Geschichte der Menschen eingetreten. Es hat gelitten unter Pontius Pilatus, geschichtlich nachweisbar, er ist gestorben und er wurde begraben. Und er ist auferstanden, er ist wahrhaft auferstanden. Es ist ein mehrfach bezeugtes Ereignis im Jahre 30. „Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen“, so sagt Petrus heute in der Apg. Paulus führt in der heutigen Lesung aus dem 1 Kor über 500 Zeugen der Auferstehung an! Ein Jurist, der ein Buch über die Auferstehung geschrieben hat, spricht von einem der bestbezeugten Ereignisse in der gesamten Menschheitsgeschichte überhaupt!
Es ist geschehen! Und doch, wäre die Auferstehung nur ein geschichtliches Ereignis, wäre sie bedeutungslos. Belanglos für uns hier und heute. Die Geschichte der Kirche bezeugt jedoch, dass die Auferstehung fortwirkt, bereits über 2000 Jahre. Ja, dass sie nicht nur bis heute und in alle Ewigkeit Auswirkungen hat, sondern dass sie stets gegenwärtig ist. Auferstehung ist jetzt – hier und jetzt. Der auferstandene ist da, mitten unter uns, ja in uns selbst. ICH BIN die Auferstehung und das Leben, sagt der Herr. Wo ER ist, da ist Auferstehung, da sind Sünde und Tod besiegt, da ist ewiges Leben.
Wie Jesus und seine Auferstehung in der Kirche gegenwärtig bleiben, zeigt uns das bekannte Evangelium von den Emmausjüngern. So, wie Jesus die beiden Jünger auf dem Weg begleitet, so geht er auch mit uns. Meist unerkannt, aber immer gegenwärtig. Seit unserer Taufe geht er den Weg mit uns. Ganz besonders aber ist er bei uns gegenwärtig, wenn sich mehrere von uns versammeln und – wie die beiden Emmausjünger, sich z.B. über ihn unterhalten, ihn in ihre Mitte stellen. Wie Jesus selbst sagte: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und so wie er den beiden die Schrift auslegt und erklärt, so ist er auch für uns immer gegenwärtig im Wort Gottes – das er selbst ja ist! In den Worten der Heiligen Schrift, spricht er nicht nur zu uns, sondern ist er tatsächlich selbst gegenwärtig. Deswegen haben die Worte der Schrift, hat das Wort Gottes auch verändernde Kraft. Auferstehung eben! Und schließlich erkennen die beiden den Herrn beim Brechen des Brotes. So können auch wir ihn immer wieder aufs Neue beim Brechen des Brotes, bei der Feier der Eucharistie als den Auferstandenen erkennen, der mitten unter uns – und durch die Kommunion auch tatsächlich IN uns – gegenwärtig wird.
Und so werden wir, wie die beiden Emmausjünger, selbst zu Zeugen der Auferstehung. Uns ist der Herr selbst begegnet. Wir haben seine lebendige, alles verändernde Gegenwart selbst erfahren! In der Geschichte gab es zahlreiche Zeugen der Auferstehung. Einige davon sind in der Hl. Schrift benannt und angeführt. Doch wir hier sind HEUTE Zeugen der Auferstehung. Und diese Botschaft, diese Frohbotschaft, dieses Euangelion sollen wir als seine Apostel hinaustragen in die Welt, um allen zu bezeugen: Der Herr ist auferstanden – Er ist wahrhaft auferstanden! Halleluja!
Diakon Markus
Palmsonntag – bei Jesus bleiben

Feierliche Einzüge von Herrschern und andern wichtigen Persönlichkeiten in eine Stadt waren in der römischen Welt ein Mittel der Machtdemonstration und der politischen Propaganda. Sie folgten einem mehr oder weniger festen Ritual. Hoch zu Ross, umgeben von seinen Offizieren, Magistraten und Soldaten traf der Erwartete vor dem Stadttor ein. Dort wurde er von den Behörden und von Vertretern der Oberschicht feierlich empfangen und unter dem Jubel der Bevölkerung in die Stadt geleitet. Hymnische Akklamationen und Jubelrufe gehörten zu diesem Ritual ebenso wie das Ausbreiten von Kleidern und Zweigen vor den Füßen des Geehrten.
Genauso wird Jesus in Jerusalem empfangen, wie ein König. Die Erwartungen, dass das Königtum Davids durch den verheißenen Messias wieder hergestellt wird waren groß. Doch einige Punkte passen nicht ganz in das Bild und erzeugen eine ganz andere Stimmung. Die Passion Christi und sein Kreuzestod liegen bereits in der Luft, kündigen sich an. Jesus kommt zuerst zum Ölberg und schickt von dort seine Jünger aus. Nur ein paar Tage später wird der Ölberg der Ort seiner schlimmsten Seelenqualen und des Verrats sein. Die Beschaffung des Reittieres Jesu erinnert an das königliche Recht auf Requirierung. Aber Jesus reitet nicht wie ein König auf einem Pferd, auf einem mächtigen Schlachtross, sondern auf einem Esel. Damit geht das Wort des Propheten Sacharia in Erfüllung, der sagt: „Juble laut, Tochter Zion! Jauchze, Tochter Jerusalem! Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft; er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin.“ Doch was für ein König wird Jesus sein?
Das Volk jubelt: „Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters David, das nun kommt.“ Die Frage ist: Was erwarten sie denn? Einen starken Befreier, der das Joch der Römer abschüttelt. Einen Messias, der allen Hunger und alles Leid beendet und dem Volk Israel zu seinem Recht verhilft. Seien wir ehrlich: Würden wir uns das nicht auch oft wünschen – einen Messias, einen von Gott gesandten König, der einmal so ordentlich dreinschlägt und mit einem Mal allen Hunger, alles Leid, alle Ungerechtigkeiten, alle Kriege auf Erden beendet?
Doch wie Jesus dann vor Pilatus sagt: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ Gottes Plan der endgültigen Befreiung sieht anders aus: Er geht über das Kreuz. Und genau dahin führt Jesu Weg. Die Menschenmassen, die im heute zujubeln, verlangen ein paar Tage später seinen Tod. Und die Jünger, die letzten die geblieben sind? Sie werden davonlaufen und ihn verleugnen. – Wo werden wir sein?
Ich möchte anregen, dass wir bei Jesus bleiben. Und zwar ganz konkret: Machen wir in der kommenden Karwoche Exerzitien, geistliche Übungen, Exerzitien im Alltag: Gehen wir in den nächsten Tagen bis Ostern mit Jesus mit, ganz bewusst. Wenn eine schwierige Situation kommt – laufen wir nicht davon. Bleiben wir mit Jesus dabei. Wenn wir beleidigt oder verletzt werden, schlagen wir nicht zurück. Bleiben wir bei Jesus.Was auch immer geschieht in den Tagen der Karwoche, in jeder Stunde, in jeder Minute: Erleben wir es als Mitgehen mit Jesus. Dann werden wir am Karfreitag nicht weit weg von ihm sein, sondern mit Maria unter dem Kreuz stehen und unseren König sehen, wie er den endgültigen Sieg errungen und uns für immer befreit hat.
Diakon Markus
Kreuzverhüllung in der Passionszeit

Die Tradition der Kreuzverhüllung, insbesondere ab dem Passionssonntag (5. Fastensonntag) bis Karfreitag, ist eine liturgische Praxis in der katholischen Kirche. Sie ist eingebettet in die vierzigtägige Fastenzeit – das ist der Zeitraum der inneren Einkehr und des Gebets in Vorbereitung auf das kirchliche Hochfest Ostern, an dem Christinnen und Christen die Auferstehung Jesu Christi feiern.
Historische Wurzeln im Mittelalter
Obwohl die genauen Ursprünge der Kreuzverhüllung nicht eindeutig feststellbar sind, lässt sich diese Tradition bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Dokumente und liturgische Bücher aus dieser Zeit belegen die Praxis, Kruzifixe, Kreuze und Heiligenbilder in Kirchen zu verhüllen, um der Trauer und Buße während der Fasten- und Passionszeit symbolisch Ausdruck zu verleihen. Früher nutzte man oft weiße Leinentücher für die Verhüllung. Heute sind die Tücher meist violett. Diese Farbe repräsentiert in der liturgischen Symbolik Übergang und Verwandlung.
Symbolische Bedeutung und Spirituelle Dimension
Die Kreuzverhüllung möchte die Gläubigen an die Ernsthaftigkeit der Fastenzeit erinnern und dient als visuelles Symbol der Trauer über das Leiden und Sterben Jesu Christi. Durch das Entfernen des gewohnten Anblicks des Kreuzes und anderer sakraler Gegenstände werden die Gläubigen in eine tiefere Reflexion über Jesu Opfer und Liebe geführt. Zugleich unterstreicht sie die vorübergehende Natur menschlichen Leidens und stärkt die Hoffnung, die aus dem Glauben an die Auferstehung entspringt.
Die Kreuzverhüllung unterstützt die innere Einkehr und lädt die Gläubigen dazu ein, über die Bedeutung des Kreuzes und die zentrale Botschaft des Christentums – die Erlösung durch Jesu Tod und Auferstehung – nachzudenken. Sie fördert eine vertiefte persönliche und gemeinschaftliche Gebetspraxis, indem sie die Aufmerksamkeit von den äußeren Bildern auf das innere Erleben des Glaubens lenkt. Zusätzlich „schweigen“ in der Karwoche mit Ende der Abendmahlsfeier an Gründonnerstag die Kirchenglocken. Die schrittweise Enthüllung des Kreuzes an Karfreitag leitet die Kreuzverehrung ein.
Christian Schmitt, In: Pfarrbriefservice.de
Neuer „Angelus“ mit Schwerpunkt „Gebet“

Die neue Ausgabe des „Angelus“ können Sie hier herunterladen!
OREMUS – LASSET UNS BETEN!
Das Thema dieser Ausgabe entstand auf natürlichem Wege aus dem pas- toralen Kontext, in dem sich die römisch-katholische Kirche aktuell befin- det, und zwar aus dem „Jahr des Gebets“, das der Heilige Vater in Rom, am 21. Januar 2024 ausgerufen hat. Es soll dazu dienen, in allen Diöze- sen der Welt, die Zentralität des Gebets wiederzuentdecken.
Papst Franziskus hatte bereits vor zwei Jahren die Ausrufung eines „Jah- res des Gebets“ angedeutet. In einem Schreiben an das mit der Vorberei- tung beauftragte Dikasterium heißt es, das Gebet sei ein Hauptweg zur Heiligkeit und ermögliche es jedem Menschen, Gott gegenüber das auszudrücken, was im Herzen verborgen sei. Außerdem soll das Va- terunser stärker in den Mittelpunkt eines jeden Christen gerückt werden und zum „Lebensprogramm“ gemacht werden.
Wie Sie sich selbst bereits überzeugen konnten, haben wir in Guben, seit einigen Wochen und Monaten, zusammen mit unserem Diakon, immer wieder die Themen der vertieften Spiritualität angesprochen und immer wieder verschiedene Impulse oder gar praktische Handreichungen und Gelegenheiten zum Gebet gegeben. Leider nicht alle haben es ernst und wahrgenommen – schade!
Fastenhirtenbrief „Im Glauben Brücken bauen“

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn!
Am Beginn der Fastenzeit erklingt das erste Wort Jesu, das er im Evangelium nach Markus spricht: „Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“. Dieser Satz ist wie ein cantus firmus des ganzen Evangeliums. Es ist die Grundmelodie christlichen Lebens, die wir in jedem Jahr in den 40 Tagen vor Ostern neu einüben und vertiefen. Ohne Umkehr und die Bereitschaft zu einem ernsthaften Neuanfang wird unser christliches Leben blass und oberflächlich. Es kann sich unbemerkt eine Erosion des Glaubens und gefährliche Gleichgültigkeit einschleichen.
Darum ist die jährliche österliche Bußzeit ein Geschenk und eine Chance, dem eigenen Glauben neues Profil zu geben und ernsthafter Christ zu sein.
Ich möchte das Jahresthema unseres Bistums zu Hilfe nehmen und daraus einige Anregungen für die Gestaltung der Fastenzeit geben. „Im Glauben Brücken bauen“ – haben wir als Überschrift über das Jahr 2024 gewählt, das auch ein Jahr der Vorbereitung und Einstimmung auf das Heilige Jahr 2025 sein wird. Papst Franziskus hat darum am Sonntag, dem 21. Januar ein „Jahr des Gebetes“ ausgerufen, in dem wir alle unsere Gottesbeziehung anschauen und erneuern sollen, ein „Jahr der Wiederentdeckung des großen Wertes und der absoluten Notwendigkeit des Gebets im persönlichen Leben.“ (Ansprache von Papst Franziskus beim Angelus am 21.01.2024) Es geht letztlich um die Befestigung der Brücken, die unseren Glauben ausmachen.
- Gott baut Brücken zu uns
Die erste Brücke hat Gott zu uns Menschen gebaut. Er hat Noach im Zeichen des Regenbogens versichert, dass er nach der großen Flut immer darauf aus sein wird, den Menschen zu retten und ihm das Heil anzubieten. Dann aber wählt Gott den alles entscheidenden Weg – er wird selbst Mensch und teilt unser irdisches Leben. „Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich außer der Sünde“, heißt es im vierten Hochgebet der Hl. Messe.
Diese Brücke von Gott zu uns wird nie mehr abgebrochen. Die Gemeinschaft der Kirche sorgt dafür, dass diese Brücke sichtbar bleibt – das hat der Herr ihr aufgetragen. Die Kirche ist das große Zeichen dafür, dass Gott seiner Zusage treu bleibt und die Brücke zu uns nie abreißen wird. In seinem Wort, das in der Heiligen Schrift aufbewahrt ist und in den Sakramenten wird diese Treue Gottes sichtbar. Am Ende unseres Lebens – so glauben wir – dürfen wir einmal zuversichtlich der Einladung Gottes folgen und ihm entgegen in das österliche Leben gehen. So baut Gott eine Brücke aus diesem irdischen Leben hin in das bleibende, ewige Leben in der großen Gemeinschaft der Heiligen. - Der Mensch als Brückenbauer
Gott hat es uns vorgemacht. Jetzt gilt es, mit ihm gemeinsam Brücken zu bauen. Dazu sind wir eingeladen. Was ist damit gemeint? Ich möchte einige Wege zeigen, wie wir als Christen zu Brückenbauern werden können.
Jedes Jahr am Aschermittwoch werden uns in einem Abschnitt aus der Bergpredigt Jesu die drei wichtigsten Übungen der Fastenzeit ans Herz gelegt: Fasten – Almosengeben – Gebet. Hinter diesen drei Worten verbergen sich Haltungen Gott und den Menschen gegenüber. Es sind drei Äußerungen der Frömmigkeit, zu denen Jesus einlädt und die dem Menschen helfen sollen, mit Leib und Seele, wahrhaftig und ehrlich seinen Glauben zu leben.
Das Fasten ist eine Übung des Verzichtes auf ganz verschiedenen Ebenen. Der Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel lehrt zum Beispiel eine neue Wertschätzung von Essen und Trinken und erinnert uns zugleich an Menschen, die nicht genug zum Leben haben. So gesehen ist es auch eine Übung der Solidarität.
Die Einschränkung eines übermäßigen Medienkonsums schafft Freiräume und Zeit für das Gespräch miteinander oder auch für Dinge, die die eigene Seele reicher machen.
Der Verzicht auf vorschnelles Urteilen über andere Menschen oder böses Geschwätz wirkt sich reinigend auf das Klima untereinander aus und trägt zu einer positiven Perspektive bei.
Fasten ist immer eine Übung des Maßhaltens. Im Verzicht will der Mensch eine neue Balance für sein Leben, die gesunde Mitte, wieder gewinnen.
Suchen wir in den kommenden Wochen unsere ganz konkrete Form des Fastens – es ist die Brücke zu einem ganzheitlichen Glauben. Fasten ist Gottesverehrung mit Leib und Seele.
Beim Almosengeben nehmen wir unsere Mitmenschen in den Blick. Wer gibt, überwindet die Angst, selbst zu kurz zu kommen.
Trotz Inflation und mancher Preissteigerung leben wir in einer Wohlstandsgesellschaft und sind in der Regel gut abgesichert. Wer teilt und von dem Seinen abgibt, trägt etwas bei zu gerechteren Verhältnissen in der Welt. Unsere Gabe soll mithelfen, dass andere Menschen in Würde leben können und dass ihnen in Notlagen geholfen werden kann.
Mit der großen Fastenaktion für MISEREOR am 5. Fastensonntag bauen wir eine Brücke des Erbarmens hin zu den Vielen, die weniger haben als wir. Ich empfehle ausdrücklich, auch unsere Kinder und Jugendlichen dazu anzuleiten, von ihrem Ersparten etwas abzugeben und mit kleinen Schritten die Bereitschaft, mit den Ärmeren zu teilen, einzuüben.
Das Almosengeben ist ein Heilmittel gegen den Egoismus. „Geben ist seliger als nehmen“, zitiert Lukas in der Apostelgeschichte ein überliefertes Herrenwort. Diese Seligkeit sollte jeder Mensch am eigenen Leib erfahren dürfen.
Als dritten Auftrag nehmen wir in diese österliche Vorbereitungszeit mit, das eigene Gebet zu vertiefen und zu erneuern. Es ist die wichtigste Brücke zu Gott und der Ernstfall unseres Glaubens.
Fragen wir uns ehrlich: Haben wir wirklich keine Zeit morgens und abends zu beten und für drei Minuten bei Gott zu verweilen? Oder haben wir es uns nicht einfach abgewöhnt und sind gleichgültig geworden nach dem Motto „Es geht auch ohne!“ Lebt in uns noch die Sehnsucht, mit Gott sprechen zu können und auch einmal neue Weisen des Betens zu entdecken und einzuüben?
In Dank und Lobpreis, in Bitte und Fürbitte drücken wir unser Vertrauen Gott gegenüber aus und lassen die Brücke zu ihm nicht morsch werden oder gar zerbrechen.
Ich freue mich sehr, dass die Zisterzienser in Neuzelle mit der Emmausvigil für die Erwachsenen und der Jugendvigil in größeren Abständen zu Zeiten des Gebetes und der Anbetung einladen und viele Menschen diese Einladung auch annehmen. Das spricht dafür, dass es auch eine neue Suche nach geistlichem Leben gibt. Aber auch die Angebote in unseren Pfarreien – die Kreuzwegandacht, die Werktagsmesse, die Gebetsgruppe oder der Bibelkreis – wollen uns helfen, die Beziehung zu Gott zu vertiefen.
Als Anregung für das persönliche Beten am Morgen und am Abend empfehle ich Ihnen ein Gebet, das mir persönlich sehr lieb geworden ist. Sie finden es auf dem Gebetsbildchen, das Sie nach der Hl. Messe mitnehmen können. Diese beiden kleinen Gebete prägen sich leicht ein und sind eine einfache tägliche Brücke zu Gott.
Liebe Schwestern und Brüder,
die österliche Bußzeit ist die kostbare Einladung, die Brücken des Glaubens zu befestigen.
Das tun wir
– im Fasten und im Verzicht auf Erlaubtes, um unseren Leib mit hineinzunehmen in unseren Glauben;
– im Almosengeben, um dem eigenen Glauben mehr Barmherzigkeit und die Bereitschaft zum Teilen zu verleihen;
– und im Gebet, um Gott wieder den Platz zu geben, der ihm gebührt und ihn im Alltag nicht zu vergessen.
So wollen wir in den kommenden 40 Tagen den Ruf Jesu ernst nehmen, der an diesem Sonntag im Evangelium erklungen ist: „Kehrt um und glaubt an das Evangelium!“ und Schritte der Erneuerung unseres Glaubens einleiten.
In meinem Hirtenbrief konnte ich einiges, wie Sie bemerkt haben, nur andeuten. Ich würde mich deshalb freuen, wenn Sie im Gespräch in den verschiedenen Gruppen der Gemeinde manches davon miteinander besprechen und vertiefen. Dann bauen Sie eine Brücke im Glauben zu anderen Mitchristen und sind dabei durch das Zeugnis anderer Menschen selbst reicher geworden.
Ich wünsche uns allen eine fruchtbare österliche Bußzeit, die unser aller Herz bereitet für die Freude des kommenden Festes.
Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater + und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Euer Bischof
+ Wolfang
Foto: Stift Heiligenkreuz
Papst ruft Jahr des Gebets aus

In Vorbereitung auf das kommende Heilige Jahr 2025 und die Öffnung der Heiligen Pforte im Dezember hat Papst Franziskus ein Jahr des Gebets ausgerufen.
„Die kommenden Monate werden uns zur Öffnung der Heiligen Pforte führen, mit der wir das Heilige Jahr beginnen werden“, erläuterte Franziskus vor den Gläubigen auf dem Petersplatz.
Am 24. Dezember 2024 soll die Heilige Pforte am Petersdom geöffnet werden. Während des Heiligen Jahres werden Millionen von Pilgern und Besuchern in Rom erwartet. In Vorbereitung darauf bitte er darum, „das Gebet zu intensivieren“, um „dieses Ereignis der Gnade gut zu leben und die Kraft der Hoffnung Gottes zu erfahren“, betonte Franziskus:
„Deshalb beginnen wir heute das Jahr des Gebets: ein Jahr, das der Wiederentdeckung des großen Wertes und der absoluten Notwendigkeit des Gebets gewidmet ist, des Gebets im persönlichen Leben, im Leben der Kirche, des Gebets in der Welt.“
Dabei könnten uns auch die Hilfsmittel unterstützen, die das Dikasterium für die Evangelisierung zur Verfügung stelle, kündigte Franziskus weiter an.
Weihnachtsgruß von Bischof Ipolt

Worte, nichts als Worte?
Ich habe seit vielen Jahren die Gewohnheit, in der Christmete nach der Verkündigung des Weihnachtsevangeliums das aufgeschlagene Evangeliar zur Krippe zu tragen und es dort vor der Heiligen Familie abzulegen. Angeregt dazu hat mich ein Bild des Priesters und Malers Sieger Köder (+ 2015). Er hat eine Krippe gemalt, um die eine Familie – Eltern und drei Kinder – staunend stehen. Aber auf dem Stroh dieser Krippe ist kein Kind zu sehen, sondern ein aufgeschlagenes Buch, in dem man die Worte lesen kann: „Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.“ (Joh 1,14) Das Bild des Malers will das anschaulich machen, was an Weihnachten geschehen ist. Mit diesem einfachen Satz aus dem Prolog des Johannesevangeliums hat der Evangelist den Kern desWeihnachtsfestes zusammengefasst.
Auch unter uns Menschen sind wir dankbar, wenn Worte nicht leer bleiben oder gar nur in den Wind gesprochen sind. Wir sind froh, wenn sich Worte bewahrheiten. Wir leben davon, dass ein einmal gegebenes Wort gehalten wird und wir uns darauf verlassen können. Von Menschen, die solche Worte sprechen und halten, sagen wir: „Auf dich kann man sich verlassen! Dir kann man vertrauen.“
Das schönste Zeichen dafür, dass Worte auch unter Menschen Fleisch werden können, ist die Ehe zwischen Mann und Frau, ist die Familie. Sie versprechen einander vor Gotes Angesicht die Treue in guten und in bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit und lösen dieses Versprechen ein Leben lang ein. In der ehelichen Gemeinschaft wird dieses Wort Fleisch im wahrsten Sinn des Wortes und es wird fruchtbar in den Kindern. Das einmal gesprochene Wort will im Alltag je neu eingeholt werden und muss sich dort bewahrheiten. Das ist zugegebenermaßen nicht immer leicht – aber unverzichtbar.
In unserer säkularen Umwelt wird Weihnachten gern als Fest der Familie bezeichnet. Man trifft sich zum Fest, weil dort Zeit und Raum für ein ausgedehntes Miteinander ist. Wenn es gut geht, wird dadurch der Zusammenhalt in der Familie tatsächlich gestärkt und bereichert, ja durch die Freude eines Festes vertieft.
Weihnachten erinnert uns daran: Bloße Worte sind Schall und Rauch. Sie müssen Fleisch werden, was so viel heißt wie: durch das Leben eingeholt und erfüllt werden. Got macht es uns vor. Seine Worte, die er an das auserwählte Volk Israel durch die Propheten zu allen Zeiten gerichtet hat, werden in der Geburt seines Sohnes Fleisch – ein Kind in der Krippe von Betlehem. Auf diese Weise hat Got die Sehnsucht des Menschen erfüllt, aber noch mehr seine eigene Sehnsucht – ein Mensch unter uns zu sein, wie es kürzlich der tschechische Priester und Philosoph Tomáš Halík ausgedrückt hat.
Mögen alle Worte und guten Wünsche, die wir an Weihnachten einander sagen oder schreiben mit unserem Leben und unserer Liebe gefüllt sein.
Das wünscht Ihnen
+ Bischof Wolfgang Ipolt
Bild: Sieger Köder
Alle Jahre wieder?

Alle Jahre wieder: Wir brauchen Weihnachten. Wenigstens einmal im Jahr erinnert sich doch der Großteil der Menschen, dass es mehr gibt, dass da noch etwas anderes ist – und wir Christen wissen, dass da noch JEMAND anderer ist. Eine Person, die uns über alles liebt: Gott selbst, der in unsere Welt hereinbricht
Wir brauchen die Wiederholungen im Kirchenjahr. Nach so vielen Weihnachten – wer hat es begriffen – wer kann es begreifen, was da wirklich geschieht? Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder aufs Neue auf das Mysterium der Menschwerdung Gottes einlassen.
Wir Katholiken haben es da gut: wir dürfen nicht nur das Wort Gottes hören, das Wort des lebendigen Gottes, das Jesus Christus selbst IST. Sondern wird dürfen ihn auch in der Liturgie erfahren.
Intellektuell können wir es niemals erfassen, dass der Ewige, Unendliche, Allmächtige ein kleines Kind in der Krippe wird. Aber wir dürfen ihn mit unseren Sinnen, ja sinnlich, erfahren, wie er hier mitten unter uns gegenwärtig wird, einen Leib annimmt, Fleisch und Blut wird.
Im Kehrvers des Psalmes und im Evangelium hören wir: HEUTE ist euch der Heiland geboren, Christus der Herr! Wir feiern nicht nur das Ereignis vor etwa 2.000 Jahren. Gott wird HEUTE Mensch, er kommt hier und jetzt zu uns und will in unseren Herzen Wohnung nehmen.
Das geschichtliche Ereignis in Bethlehem ist natürlich grundlegend und hat den Lauf der gesamten Menschheitsgeschichte, von ihrem Beginn bis zum Ende verändert. Aber wenn es ein isoliertes Ereignis in der Geschichte geblieben wäre, wozu sollten wir dann heute feiern?
So kommen wir wieder zur Liturgie, die das Wirken Jesu Christi in der Zeit fortschreibt. Das GEDÄCHTNIS seiner Geburt – wie auch seines Todes und seiner Auferstehung – ist ganz im jüdischen Verständnis dieses Wortes „Gedächtnis“ nicht nur Andenken, sondern eben VERGEGENWÄRTIGUNG.
Wenn wir bereit sind, im Stande der Gnade sind, dann kommt der Herr JETZT zu uns. Er kommt als kleines Kind in die Krippe, er kommt als kleine Hostie zu uns. Und unser Herz wird zur Krippe, die ihn aufnehmen und tragen darf.
Diakon Markus